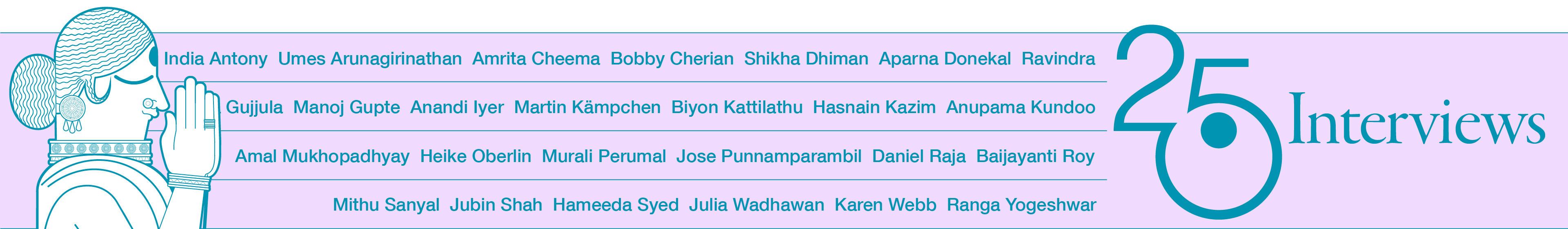(click here for English version)

Er kam 1973 aus Indien in die DDR, wurde Arzt in Altlandsberg – und 1993 der erste indischstämmige, „dunkelhäutige“ Bürgermeister Deutschlands. Ravindra Gujjula (*1954), SPD-Mitglied und bis heute kommunalpolitisch aktiv, erzählt von einem Weg, der geebnet wurde von dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“. Im Interview spricht Gujjula über seine Prägung durch die DDR-Jahre, gibt Einblicke in das Geheimnis erfolgreichen Wirkens und verrät uns, wie es gelingt, allen Widrigkeiten zum Trotz Dinge auf die Beine zu stellen, die nachhaltig das Leben der Menschen verbessern: durch Bürgernähe, Klinkenputzen und Bodenständigkeit. Er unterstreicht, wie wichtig der Kampf gegen Rechtsextremismus und für Demokratie ist, fordert mehr politisches Engagement von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und eine SPD, die ihre Erfolge besser erklärt. Ein Gespräch über Zugehörigkeit, Verantwortung – und darüber, wie man Herzen gewinnt, ohne sich zu verbiegen.
Herr Gujjula, wie sind Sie ursprünglich nach Deutschland gekommen?
Vor einem gefühlten halben Jahrhundert, 1973, kam ich zum Medizinstudium in die damalige DDR. Die DDR bot jedes Jahr einige Studienplätze für ausländische Studenten an, und ich hatte mich parallel auch in England und Russland beworben. Da ich aber immer Arzt werden wollte, habe ich mich für dieses mir damals noch sehr unbekannte Land, die DDR, entschieden.
Sprachen Sie damals schon Deutsch?
Nein, ich kam ahnungslos in die DDR. Nach meiner Ankunft musste ich erst eineinhalb Jahre Deutsch lernen, um auch die ganzen Fachbegriffe zu beherrschen. 1975 konnte ich dann in Greifswald mit dem Medizinstudium anfangen.
Ich hatte aber Glück, dass ich fast nur deutsche Freunde und Kommilitonen hatte. Wenn ich mich verständigen wollte, blieb mir also gar nichts anderes übrig, als Deutsch zu sprechen.
Von 1993 bis 2003 waren Sie Bürgermeister von Altlandsberg und damit der erste indischstämmige und „dunkelhäutige“ Bürgermeister in Deutschland. Was hat Sie damals motiviert, für dieses Amt zu kandidieren? Hatte Ihre Erfahrung in der DDR vielleicht einen Einfluss auf Ihr demokratisches Engagement?
Da muss ich ein bisschen ausholen: Ich komme aus einer politisch aktiven Familie in Indien. Mein Vater war zwanzig Jahre lang Abgeordneter, das hat mich geprägt. Auch meine Mutter war bis zu ihrem Tod Generalsekretärin des größten Frauenverbandes Indiens. So war ich von Anfang an linksorientiert und bin mit sozialistischen Gedanken groß geworden.
In der DDR habe ich mich dann zum Beispiel für Mandelas Freiheit und gegen die Apartheid engagiert. Das waren politische Aktivitäten, die dort auch geduldet waren.
Mein eigentliches politisches Engagement begann kurz vor dem Mauerfall. Ein neues DDR-Gesetz erlaubte Ausländern nach fünf Jahren Aufenthalt, an Kommunalwahlen teilzunehmen und auch zu kandidieren. Die Krankenhausgewerkschaft schlug mich für den Kreistag vor. Der Kreiswahlleiter fragte mich, wie viele Inder es in Altlandsberg gebe. Als ich antwortete, dass ich der einzige sei, wollte er wissen, in wessen Interesse ich dann kandidiere. Drei Tage später bekam ich einen Brief: Man bedankte sich für meine Bereitschaft, erklärte aber, dass meine Kandidatur nicht akzeptiert werde.
Das war der erste wesentliche Widerspruch, mit dem ich in der DDR konfrontiert war: Wenn es freie Wahlen gibt und Kandidaten frei aufgestellt werden dürfen, wie kann es dann sein, dass man sagt, du darfst nicht kandidieren? Es gab dafür keine Begründung. Also schrieb ich einen Brief an den DDR-Wahlleiter Egon Krenz, der kurz vor dem Mauerfall dann auch der letzte SED-Parteivorsitzende wurde. Nach sieben Tagen hatte ich noch keine Antwort – stattdessen wurde mir im Krankenhaus gekündigt.
Daraufhin war ich eine ganze Weile arbeitslos. Ich bin dann mit meinem Sohn nach Indien gefahren und habe dort im Krankenhaus gearbeitet. Aber ich sah, wie es in der DDR brodelte, wie immer mehr Menschen flohen. Man wusste: Dieses System kann nicht mehr lange überleben, im selben oder im nächsten Jahr würde die Mauer fallen.
Deshalb bin ich nach vier Monaten wieder zurück in die DDR gekommen, auch weil meine Frau und meine Tochter dort geblieben waren. Ich habe mich wieder am selben Krankenhaus beworben und wurde mit Kusshand genommen, denn es herrschte Ärztemangel. Mein „Glück“ war, dass man mich in die Ambulanz schickte – quasi als kleine Strafmaßnahme. Dort hatte ich mit den Menschen zu tun, die täglich arbeiteten und anpackten. Ich konnte täglich mit ihnen reden – und da bin ich irgendwie ein anderer Mensch geworden. Ich ging mit auf die Demonstrationen am Alexanderplatz, nahm an Aktionen in Berlin und Umgebung teil – und schließlich fiel die Mauer.
Die Wahlen, für die ich nicht kandidieren durfte, wurden annulliert. Nach dem Mauerfall fanden in der DDR freie Wahlen statt. Ich reichte erneut meine Kandidatur ein, diesmal wurde sie akzeptiert – und ich wurde mit der zweithöchsten Stimmenzahl in das Stadtparlament von Altlandsberg gewählt. So wurde ich Abgeordneter, ohne eigentlich die nötige Erfahrung zu haben.
Von 1991 bis 1993 sammelte ich erste politische Praxis. 1993 gab es dann die ersten Kommunalwahlen nach bundesdeutschem Recht. Dafür brauchte man die deutsche Staatsbürgerschaft. Also verabschiedete ich mich von meinem ursprünglichen Plan, irgendwann nach Indien zurückzukehren, stellte meinen Einbürgerungsantrag – und bekam genau rechtzeitig den deutschen Pass. Auf die Frage im Formular, warum ich Deutscher werden wolle, schrieb ich: „Ich bin Abgeordneter in Altlandsberg und möchte für das Bürgermeisteramt kandidieren. Das geht nur mit deutscher Staatsbürgerschaft.“
1993 kandidierte ich schließlich parteilos gegen Bewerber von CDU, SPD, FDP und einen weiteren Parteilosen. Im ersten Wahlgang lag ich mit 43 Prozent vorne, der CDU-Amtsinhaber erreichte 25 Prozent. In der Stichwahl gewann ich mit knapp 62 Prozent – völlig unerwartet wurde ich Bürgermeister.
Das war eine Entwicklung: Man beschließt nicht einfach, Bürgermeister oder Arzt zu werden. Man muss dafür viel tun – und trotzdem ging ich ziemlich ahnungslos ins Amt. Ich kannte die Probleme, aber wie man sie in einem vereinigten Deutschland lösen sollte, das war für mich eine große Herausforderung.
1998 trat ich erneut an und wurde mit 81 Prozent wiedergewählt. Nach drei Wahlen hatte ich gelernt, dass man sich mit Engagement durchsetzen kann, dass man Klinken putzen muss – und inzwischen kannte man mich weit über Altlandsberg hinaus. Internationale Medien berichteten über mich, von der New York Times bis zu japanischen Fernsehteams.
So bekam ich auch Zugang zur Landespolitik. Mich unterstützten die Linken, die SPD, aber auch die CDU – ich war ja parteilos. Irgendwann stellte sich dann die Frage, ob ich für den Kreistag oder den Landtag kandidieren solle. Doch weil ich parallel als Arzt arbeitete, war das nicht einfach.
Altlandsberg wurde später mit mehreren Gemeinden fusioniert. Aus den bisherigen Bürgermeistern wurden ehrenamtliche Bürgermeister und später Ortsvorsteher. Ich selbst war zehn Jahre lang direktgewählter Bürgermeister, danach fünf Jahre Ortsbürgermeister und noch einmal zwei Legislaturperioden Ortsvorsteher. Nach 25 Jahren habe ich dann aufgehört – ich hatte, wie man so sagt, „die Schnauze voll“ (lacht). Vor sechs Jahren habe ich nicht mehr kandidiert, und heute ist interessanterweise meine Frau Ortsvorsteherin.
Bei den Kommunalwahlen trete ich aber weiterhin an und bin seit über 25 Jahren Kreistagsabgeordneter – immer mit sehr guten Ergebnissen. Ich hätte auch hauptamtlicher Bürgermeister werden können, aber das wollte ich nicht. Mir war wichtig, meinen Beruf als Arzt zu behalten. Dadurch konnte ich mich im Ort engagieren, Vereine unterstützen und den direkten Kontakt zu den Menschen bewahren.
Bis heute engagiere ich mich sehr aktiv ehrenamtlich. Irgendwann haben mich Parteien gefragt, ob ich bei ihnen mitmachen wolle. Für mich war die Entscheidung einfach: Nachdem ich zum zweiten Mal zum Bürgermeister gewählt worden war, habe ich mich für die Sozialdemokratie entschieden.
Seitdem trete ich auf Landesebene als SPD-Mitglied auf, habe aber in Altlandsberg meine parteilose Haltung beibehalten. Das hat mich dort eigentlich zum beliebtesten Politiker gemacht.
Nach einem kurzen Ausflug in den Landtag bis 2009 habe ich einmal für den Bundestag kandidiert und verloren, ebenso zweimal knapp für den Landtag.
Was mich motiviert hat? Vor allem die Mitmenschen und die gesellschaftlichen Missstände – damals in der DDR, aber auch heute in ganz Deutschland. Nun habe ich ein gewisses Alter erreicht. Viele sagen, irgendwann solle man sich zurückziehen. Aber ich sage: Solange ich arbeite und aktiv mit Menschen zu tun habe, kandidiere ich auch. Deshalb wurde ich auch bei den letzten Kommunalwahlen wieder in den Kreistag und ins Stadtparlament gewählt.
Sie haben sich engagiert, seitdem sie in die DDR gekommen sind. War das ihr Schlüssel, die Herzen der Menschen für sich zu gewinnen?
Ich sage mal so: Ich bin sehr bürgernah, mit allen per Du. Ich war in den Kneipen präsent, bei allen Aktivitäten, in der Kirche – einfach überall. Ich habe viele Vereine gegründet: gleich nach meiner ersten Wahl nach dem Mauerfall den Gewerbeförderverein und den Heimatverein, die bis heute sehr aktiv sind. Ich habe Sportvereine wiederbelebt und unterstützt, bin Ehrenmitglied im Schützenverein Altlandsberg und im Männerturnverein.
Diese basisnahe Politik war entscheidend. Keine großen Sprüche klopfen, keine leeren Versprechen. Wir haben alles nach und nach geschafft. Als ich begann, hatten wir fast 18 Prozent Arbeitslosigkeit und einen absoluten Wohnungsmangel. Heute gibt es zwar immer noch zu wenig Wohnungen, aber jeder in Altlandsberg kann eine Wohnung oder ein Haus finden. Wir haben viele verfallene Gebäude im historischen Stadtkern saniert und für geringe Mieten an ältere Bürger vergeben. Das sind alles Dinge, die die Menschen nicht vergessen werden.
In den letzten Jahren sind viele Fördermittel nach Altlandsberg geflossen. In der Fördermittel-Hitliste des Landes Brandenburg lagen wir immer auf den vorderen Plätzen. Wir sind sehr gut im Klinkenputzen. So konnten wir die Einwohnerzahl verdoppeln, neue Schulen bauen, eine neue Sport- und Mehrzweckhalle errichten. Das sind alles Bedürfnisse der normalen Bürger. Das sind alles Dinge, mit denen ich das Vertrauen der Menschen gewonnen habe.
Und das Wichtigste ist: Diese Menschen betrachten mich trotz meiner dunklen Hautfarbe nicht als Ausländer, sondern für die bin ich einer von ihnen – mit einer ähnlichen Biografie, denn ich habe siebzehn Jahre in der DDR gelebt. Deshalb habe ich die gleichen Themen, über die wir uns austauschen können.
Gab es Erfahrungen oder Werte aus Ihrer indischen Herkunft, die Sie in Ihre kommunalpolitische Arbeit eingebracht haben?
Ja, viele. Das Wichtigste ist, Menschen zuzuhören. Nicht irgendwie an die Decke zu gucken und zu denken: „Wie lang dauert das hier noch?“ Man fühlt mit, man stellt Fragen, man kommt in die Sache rein. Das hat mir geholfen, ein guter Arzt zu sein, in dem Sinne, dass Menschen Vertrauen zu mir gewinnen.
Das Zweite ist: Wenn Menschen mit Problemen kommen und ich Lösungen anbiete, dann sieht man, dass man auch mit den bescheidenen Mitteln, die ein Bürgermeister einer Kleinstadt hat, sehr gut im Sinne der Menschen arbeiten und etwas schaffen kann. Ich denke, das habe ich aus Indien mitgebracht: zuhören können, neugierig sein und sehen: Welche Probleme bringen die Menschen mit?
Und noch etwas: Ruhe zu bewahren, auch in ernsten Situationen, und über Lösungen nachzudenken. Diese gewisse indische Mentalität hat mir geholfen, den Menschen näherzukommen.
…Auch das Improvisieren?
Ja, das Improvisieren gab es in Indien wie in der DDR. Wenn eine Maschine kaputt war, musste man improvisieren, weil es keine Ersatzteile gab. Sie kennen ja den Spruch: „Geht nicht, gibt’s nicht.“ Man muss schauen, welche Mittel man hat, denn nichts ist unmöglich. Es gibt immer einen Weg – man muss ihn finden.
Als wir die Turn- und Sporthalle bauen wollten, haben viele gelacht: „Wir haben nicht mal Geld für Wohnungen, woher soll das für eine Halle kommen?“ Und doch haben wir sie gebaut – heute ist sie aus dem Gemeindeleben nicht wegzudenken. Ähnlich beim Gymnasium: Auch da haben viele gezweifelt, und jetzt haben wir seit vergangenem Jahr eines der modernsten Gymnasien für 64 Millionen Euro – etwas, das man selbst in Großstädten kaum findet. Ich bin sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dafür zu kämpfen und das mit den nötigen taktischen Zügen zu ermöglichen.
Solche Beispiele zeigen: Es gibt eigentlich keine Grenzen – man muss nur daran arbeiten.
Haben Sie Ihre langjährige praktische Erfahrung in der deutschen Kommunalpolitik für eine Art Wissenstransfer nach Indien genutzt? Stehen Sie im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen dort? Und wie beurteilen Sie die Möglichkeiten kommunaler Zusammenarbeit zwischen Indien und Deutschland?
Wir haben sehr gute partnerschaftliche Beziehungen mit ein paar indischen Gemeinden. Das hat sich 2004 nach dem Tsunami entwickelt: Ich bin damals vor die Presse gegangen und habe um Hilfe gebeten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 54.000 Euro zusammen, später konnten wir mit Fördermitteln fast 900.000 Euro in Indien investieren. Damit bauten wir sechs Grundschulen in Dörfern, in denen es keine Schulen gab, und 250 Häuser für Fischerfamilien – alles auf Hilfe-zur-Selbsthilfe-Basis, gemeinsam mit den Menschen vor Ort und der indischen Regierung.
Aus diesen Kontakten hat sich entwickelt, dass seit Jahren regelmäßig Gruppen von jungen Menschen aus unserem Kreis vier bis sechs Wochen in Indien verbringen und dort solidarische Projekte unterstützen. Umgekehrt kommen auch Politiker, zum Beispiel aus Vijayawada, regelmäßig nach Deutschland.
Zudem habe ich Freunde in Indien – Abgeordnete, Minister, Staatssekretäre –, mit denen ich mich etwa über erneuerbare Energien austausche. Der Austausch ist rege, basiert aber vor allem auf persönlichen Beziehungen.
Wenn Sie heute auf Ihre Heimatstadt Altlandsberg blicken – die AfD ist dort inzwischen stärkste Kraft –, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Und wie sehen Sie die politische Lage in Deutschland insgesamt?
Es ist nicht überraschend, was wir hier in Deutschland erleben. Das hat sich schon vor 20 Jahren abgezeichnet. Und vor zehn Jahren wurde noch klarer, dass die Entwicklung in eine bestimmte Richtung geht. Ich zweifle daran, dass Deutschland je wirklich etwas gegen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus tun wollte. Wer an der Macht war und sagte: „Wir dulden keinen Antisemitismus und keine Ausländerfeindlichkeit“, hätte handeln können – Gesetze beschließen, Maßnahmen ergreifen. Aber außer Lippenbekenntnissen passierte nicht viel.
Die AfD ist eine Folgeerscheinung der gesamten Politik, die in Deutschland betrieben worden ist. Die Menschen wählen sie nicht, weil sie Vertrauen in sie haben, sondern aus Protest. Anfang letzten Jahres ging die Meldung von diesem Treffen von Rechtsradikalen in einem Brandenburger Hotel durch alle Medien. Damals war die Empörung groß, heute spricht niemand mehr darüber – und „Remigration“ ist offizieller Bestandteil der AfD-Politik. Obwohl die Menschen das wissen, geben sie ihr über 20 Prozent der Stimmen.
Worüber ich traurig bin: In Indien gibt es Analphabetismus, und Stimmen lassen sich kaufen. Aber in einem Land wie Deutschland, wo alle lesen und schreiben können, wo alle wissen, dass von hier der Erste und Zweite Weltkrieg ausgingen und Millionen Menschen unschuldig ihr Leben verloren haben – all diese Dinge interessieren die Leute nicht, obwohl sie gebildet sind. Ich wundere mich, dass heute mehr als 20 Prozent der Bevölkerung eine rechtsextremistische Partei wählen, obwohl sie wissen, wohin das führen kann.
Die Wähler der AfD sind nicht alle dumm oder Rechtsextremisten. Aber aus Protest diese Partei zu wählen – das kann ich mir dümmer kaum vorstellen. Es gibt Hunderttausende Möglichkeiten, Protest zu zeigen. Dafür muss man nicht die AfD wählen.
Die meisten Menschen kennen die AfD-Kandidaten gar nicht. Niemand weiß, wer der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag ist, und doch ist die Partei in Brandenburg zweitstärkste Kraft nach der SPD. Ich denke, die Situation kann sich wieder bessern – vielleicht nach einer oder zwei Wahlen, wenn die AfD geoutet wird und die Menschen merken: Je extremer sie auftritt, desto enger werden die Schlingen um die AfD gezogen. Auf diesen Tag warte ich.
Momentan ist es so: Normal und vernünftig, so wie ich vor 20, 30 oder 40 Jahren reden konnte, versteht das kein Mensch mehr. Heute wollen die Leute extreme Aussagen, extreme Diskussionen. Ob ich Lust und Laune habe, mich auf dieses Niveau herunterziehen zu lassen, weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es eine Entwicklung, die die gesamte Bundesrepublik betrifft. Man muss schauen, wo das hinführt. Es gibt überall Initiativen gegen Rechtsradikalismus – aber bisher sind sie fruchtlos.
Seit 30 Jahren hört man das Klischee, Ostdeutschland sei besonders rechtsradikal geprägt – Stichworte wie „national befreite Zonen“ kursieren seit Jahrzehnten. Würden Sie sagen, dass die heutige Etablierung der AfD im Osten strukturell durch NPD und andere rechtsradikale Organisationen vorbereitet wurde, also die Bevölkerung gewissermaßen schon auf diese Ideologie eingeschworen war? Oder ist das eher ein Klischee?
Zu DDR-Zeiten konnte ich als Ausländer nachts in die Kneipe oder auf die Straße gehen – ich habe nie etwas gefürchtet. Die Diktatur hat ihre ganze Macht eingesetzt, um rechte Tendenzen kleinzuhalten. Nach dem Mauerfall brach das auf: Jeder konnte plötzlich sagen, was er wollte – eine falsch verstandene, falsch ausgeübte Freiheit und Redefreiheit.
Kurz nach den Wahlen war klar: Wenn vorher Diktatur herrschte, folgt danach Anarchie – weil sich alles neu formieren musste. So war es in Russland, in anderen sozialistischen Ländern und eben auch in der DDR. Viele Menschen sind dabei auf der Strecke geblieben. Manche, die früher Sozis waren, sind heute Nazis. Man suchte eine neue Plattform.
Die alten rechtsradikalen Parteien – Republikaner und andere – konnte man nicht wählen, weil man sofort als rechtsradikal galt. Bei der AfD war das anders: Sie wurde nicht von Nazis oder „Faschos“ gegründet, sondern von intelligenten Leuten. Anfangs ging es nicht um „Deutschland den Deutschen“, sondern um die Währungsfrage – „Wir wollen unsere D-Mark zurück.“
Dass daraus die AfD wurde, wie wir sie heute kennen, liegt daran, dass diese Plattform sehr geschickt genutzt wurde. Heute werden Dinge gesagt, die eigentlich nicht legal sind, aber so formuliert, dass es gerade noch sagbar ist. Und so fallen die Menschen darauf herein und gehen mit. „Remigration“ – was soll das sein? So etwas gibt es gar nicht. Es gibt einfach Migration. Die AfD erfindet Wörter, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Aber ich denke nicht, dass das alles im Osten vorbereitet wurde. Schauen Sie sich die Köpfe der AfD an: Björn Höcke zum Beispiel kommt aus dem Westen. Früher hieß es, in einem wohlhabenden Land wie Bayern könne die AfD keinen Fuß fassen. Heute sehen wir, wie stark sie im Bayerischen Landtag vertreten ist. Das hat also nichts mit Ost oder West zu tun, sondern ist ein allgemeiner Trend, der im Osten nur früher und deutlicher sichtbar wurde. Die Ideen wurden aus dem Westen hereingetragen – sie stammen nicht aus dem Osten, wo die Menschen von Kindesbeinen an mit einem gewissen Solidaritätsprinzip großgeworden sind.
Die neue Generation aber, die im neuen Schulsystem aufwächst und manchmal kaum noch weiß, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wählt anders als meine Generation. Und wir sehen ja auch, wie die AfD in westlichen Bundesländern immer stärker wird. Das zeigt, wohin die Reise geht.
Sollten sich mehr Menschen mit Migrationsgeschichte ein Beispiel an Ihnen nehmen und sich aktiv in Gesellschaft und Politik engagieren? Was raten Sie jungen Migrantinnen und Migranten, die heute in die Politik gehen wollen?
Keine Frage – das habe ich immer gefordert. Schon 1993 wurde ich dafür nicht verstanden: „Warum sollen wir als Ausländer politisch aktiv sein? Wir sind zum Studieren gekommen, arbeiten hier, haben hier geheiratet oder sind hier geboren – wir sind ganz normale Bürger.“ Aber ich sage: Im Gegenteil, ich fordere das von ihnen.
Denn jeder, der hier lebt, hat seinen Lebensmittelpunkt hier – nicht in der Türkei, in Indien oder irgendwo in Afrika. Und wenn man hier lebt, sollte man sich auch politisch hier engagieren, statt später nur zu meckern. Wer Wahlrecht fordert, muss auch bereit sein, für politische Ämter zu kandidieren und Verantwortung zu übernehmen.
Ich war der erste indische Bürgermeister in Deutschland. Danach gab es noch einen, irgendwo in Sachsen, der aber nach sechs Monaten schon wieder aufhörte. Dann kam lange nichts. Heute gibt es immerhin ein neueres Beispiel: In Nordrhein-Westfalen wurde ein Afrikaner hauptamtlicher Bürgermeister. Aber es bleibt selten. Auch im Landtag Brandenburg war ich der erste dunkelhäutige Abgeordnete.
Heute haben wir schon mehr Landtags- und Bundestagsabgeordnete mit Migrationshintergrund. Und ich sage: Es ist eine Pflicht. Wenn wir unseren Lebensmittelpunkt hier haben, müssen wir uns auch um die soziale Entwicklung kümmern. Wir müssen nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden und Verantwortung übernehmen. Das ist ein Muss.
Ich würde nicht nur sagen: „Ich habe ausländische Herkunft, ich muss etwas machen“, sondern: „Ich wohne hier, mein Lebensmittelpunkt ist hier, ich muss mich für meine Gesellschaft hier engagieren!“
„Ich – einer von hier!“ Dieses Gefühl muss in unseren Köpfen sein.
Ich sehe leider immer noch, wie indische Familien zusammenkommen und indische Feste feiern – was völlig in Ordnung ist –, und einige von ihnen nach vielen Jahren in Deutschland noch immer kein Deutsch sprechen, obwohl sie hier bis zum Ende ihres Lebens bleiben werden. Oder dass Kinder hier geboren werden, aber zu Hause nur Türkisch, Arabisch oder die Sprache der Eltern sprechen. Das ist für mich nicht akzeptabel. Wie können wir hier leben, wenn wir die Sprache des Landes nicht sprechen? So etwas schafft auch Raum für rechtsradikale Tendenzen.
Ich bin absolut der Meinung, dass Inder wie auch andere Migranten – egal woher – und ihre Kinder sich für die Gesellschaft engagieren müssen. Sie müssen die Sprache lernen, die politische Situation kennen, mitreden und mitbestimmen.
Was muss – Ihrer Meinung nach – Ihre Partei, die SPD, heute anders oder besser machen, um wieder mehr Menschen für sich zu gewinnen?
Zwei Dinge. Erstens: Die SPD ist im Bundestag schwach, und auch auf Landesebene – selbst dort, wo sie einmal stärkste Kraft war. Das heißt aber nicht, dass die SPD untätig war oder ihre Ziele aufgegeben hat. Viele Gesetzesinitiativen der vergangenen Jahre gehen auf die SPD zurück, auch wenn sie nicht stärkste Kraft war. Ein Beispiel ist der Mindestlohn. Dass es ihn in Deutschland so lange gar nicht gab – als einem der letzten europäischen Länder – ist eigentlich ein Skandal.
Und: Die SPD macht zwar ihre Arbeit, aber die Spitze ist nicht fähig genug, das auch zu verkaufen. Es müssen neue Leute aus der nächsten Generation nachrücken, die Politik besser erklären und die Menschen mitnehmen können.
Wir brauchen Menschen, deren Namen man mit der SPD verbindet. Klar, wir können nicht jedes Jahr einen Willy Brandt, einen Helmut Schmidt, einen Egon Bahr oder einen Herbert Wehner haben. Aber das sind die Politiker, die mich motiviert haben, in die SPD einzutreten.
Wenn wir zum Beispiel sehen, dass der Pflegeberuf allein durch den Mindestlohn wieder viel attraktiver geworden ist, dann ist das schon eine große Sache. Aber obwohl die SPD zusammen mit Grünen und Linken bei diesem Gesetz treibende Kraft war, kommt das offenbar bei den Menschen nicht an.
Trotzdem vertraue ich, dass es gelingen wird, diese Dinge in Zukunft wieder positiv zu positionieren.
…Die Hoffnung darf man nicht aufgeben, oder?
Absolut nicht.
Ich selbst bereite jetzt auch wieder Aktionen gegen Rechtsradikalismus vor. Ich war Vorsitzender von „Brandenburg gegen Rechts“ und habe viele Veranstaltungen organisiert.
Ich habe Schüler nach Theresienstadt geführt, damit sie sehen: Es gab den Zweiten Weltkrieg, es gab Gaskammern und es gab die Vernichtung der Juden.
Zu meiner Zeit musste noch jeder Schüler einmal in seiner Schulzeit Buchenwald besucht haben. Heute ist das alles freiwillig. Und wenn ich sehe, wie wenig Raum an manchen Schulen den Themen Zweiter Weltkrieg, Menschenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit gegeben wird, ist das erschreckend. Viele Schulen haben sogar AfD-Schülergruppen. Wenn wir weiter zulassen, dass das stattfindet, ist das brandgefährlich.
Für mich als friedliebenden Menschen ist Ziel Nummer eins, den Rechtsradikalismus zu bekämpfen – und dafür ist mir jedes Mittel recht. Bevor es am Ende zu spät ist.
…Also befürworten Sie ein Verbotsverfahren gegen die AfD?
Ich habe mich bisher immer gegen ein Verbot ausgesprochen, weil ich der Meinung bin: Man muss das politisch klären, nicht durch ein Verbot. Denn wo gehen die 20 Prozent der Menschen, die AfD wählen, dann hin? Die verschwinden ja nicht, sie suchen sich eine andere Plattform. Es gibt viele andere Wege, damit umzugehen. Sollte die AfD allerdings so weit kommen, dass sie gegen den Staat arbeitet, müsste sie verboten werden. Bisher war ich jedoch immer gegen ein Verbot.
Herr Gujjula, vielen Dank für dieses Gespräch!
Foto: (c) SPD