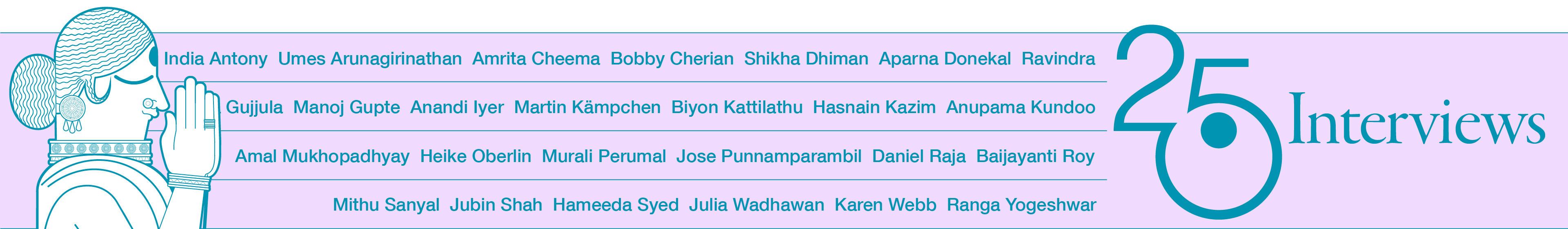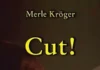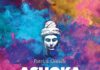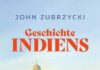Indien bestätigt erneut seinen Ruf als eine der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt. Nach aktuellen Daten von Germany Trade & Invest (GTAI) wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Finanzjahr 2024/25 um rund 6,5 Prozent – ein Tempo, das in dieser Größenordnung weltweit kaum eine andere große Volkswirtschaft erreicht. Auch für das laufende Finanzjahr 2025/26 rechnen Analysten mit einem ähnlich starken Wachstum zwischen 6,5 und 6,8 Prozent. Damit bleibt Indien ein zentraler Motor der globalen Konjunktur, getragen vor allem durch eine robuste Binnennachfrage und hohe staatliche Investitionen in Infrastruktur, Energie und Digitalisierung.

Der Binnenkonsum spielt dabei eine Schlüsselrolle. Etwa zwei Drittel der indischen Bevölkerung leben auf dem Land, wo die Kaufkraft nach guten Ernten und einer soliden Monsunsaison weiter zulegt. Für 2025/26 erwartet GTAI ein Plus von rund 7,1 Prozent beim privaten Verbrauch. Das stärkt insbesondere Branchen wie Konsumgüter, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen. Hinzu kommt, dass wachsende Einkommen im Mittelstand und ein Ausbau digitaler Bezahlsysteme den Binnenmarkt zunehmend diversifizieren. Die demografische Dynamik – ein junges, konsumfreudiges Bevölkerungspotenzial – bleibt einer der wichtigsten Wachstumstreiber.
Trotz der insgesamt positiven Entwicklung zeigt sich, dass der private Investitionszyklus noch nicht voll in Gang gekommen ist. Zwar sollen die Bruttoanlageinvestitionen im Jahr 2025/26 um etwa 6,5 Prozent steigen, doch bleibt die Kapazitätsauslastung vieler Unternehmen moderat. Gründe liegen in anhaltender Bürokratie, teils schwierigen Finanzierungsbedingungen und regionalen Ungleichheiten. Staatliche Großprojekte – etwa im Straßenbau, in der Energieversorgung und im Bahnsektor – kompensieren diese Zurückhaltung teilweise, schaffen aber noch keine dauerhafte Investitionsbasis im Privatsektor.
Im Außenhandel zeigt Indien eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Turbulenzen. Die jüngsten US-Zusatzzölle treffen einzelne exportorientierte Sektoren wie Textilien, Edelsteine oder Meeresfrüchte, wirken sich aber bislang kaum auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum aus. Mit Exporten im Wert von rund 81 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten bleibt der US-Markt zwar wichtig, doch ist Indiens Wirtschaftsstruktur weit weniger exportabhängig als etwa die vieler südostasiatischer Länder. Zugleich versucht Neu-Delhi, durch Handelsabkommen und strategische Partnerschaften seine Lieferketten zu diversifizieren und stärker regionale Märkte zu erschließen.
Für Deutschland gewinnt der Subkontinent zunehmend an Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2025 importierte Deutschland Waren im Wert von etwa 8,7 Milliarden US-Dollar aus Indien – ein Zuwachs von knapp zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die deutschen Exporte nach Indien legten zu, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Das geplante Freihandels- und Investitionsschutzabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union könnte diesen Trend weiter verstärken. GTAI rechnet jedoch nicht mit einem umfassenden Abschluss in einem Schritt; vielmehr dürfte das Abkommen schrittweise umgesetzt werden. Als Hindernisse gelten weiterhin nichttarifäre Handelsbarrieren, etwa bei Qualitätskontrollen und Zertifizierungen.
Die Analyse der GTAI zeichnet ein ausgewogenes, datenbasiertes Bild der indischen Wirtschaft, vernachlässigt jedoch einige strukturelle und gesellschaftliche Aspekte. So bleiben die Ursachen für die verhaltene Investitionstätigkeit im Privatsektor nur oberflächlich behandelt. Themen wie Arbeitsmarktreformen, Landnutzungsrechte oder die Rolle des föderalen Systems bei der Wirtschaftssteuerung werden nicht vertieft. Ebenso fehlen Einschätzungen zur ökologischen Nachhaltigkeit des Wachstums – etwa zur Rolle erneuerbarer Energien, des Green Hydrogen-Mission-Programms oder zur Dekarbonisierung der Industrie.
Auch technologische Entwicklungen, etwa im Bereich künstlicher Intelligenz, Digital Health oder Life Sciences, finden kaum Erwähnung, obwohl sie zunehmend zur Diversifizierung der indischen Wirtschaft beitragen. Diese Lücken mindern zwar nicht den Informationswert des Artikels, zeigen aber, dass die wirtschaftliche Dynamik Indiens heute stärker interdisziplinär gedacht werden muss – jenseits klassischer Kennzahlen von Produktion und Konsum.
Insgesamt bietet der GTAI-Bericht einen fundierten Überblick über Indiens makroökonomische Lage und seine wachsende Bedeutung als Investitionsstandort. Er unterstreicht die Rolle des Binnenmarkts als Stabilitätsanker und die Chancen für internationale Partner, insbesondere Deutschland. Doch wer ein vollständiges Verständnis der indischen Wirtschaftsentwicklung sucht, sollte ergänzend strukturelle, technologische und nachhaltigkeitsbezogene Perspektiven einbeziehen – denn Indiens Wachstum ist zwar stark, aber in seiner Tiefe weit komplexer, als es die reinen Zahlen vermuten lassen.