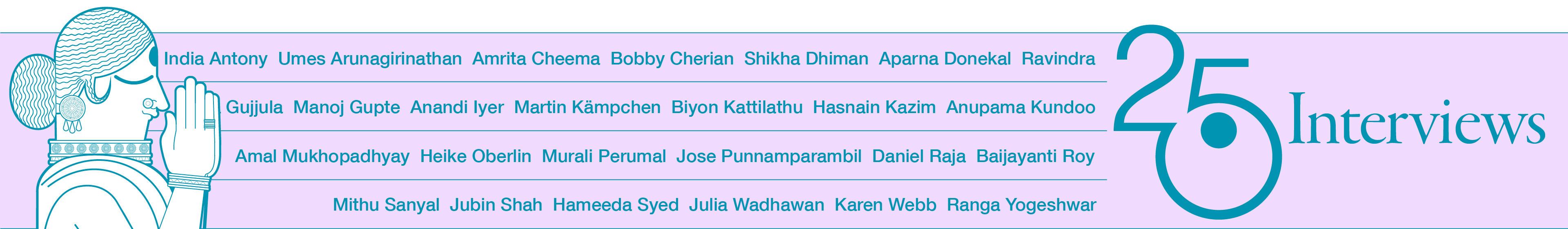„A tiger caged“, ein eingesperrter Tiger, so bezeichnete das angesehene britische Wirtschaftsblatt „Economist“ 1990 die indische Wirtschaft unter Anspielung auf die südostasiatischen Länder Thailand, Südkorea, Hongkong, Singapur und Taiwan, die aufgrund ihrer rasanten Wirtschaftsraten in den achtziger Jahren die „fünf springenden Tiger“ genannt wurden. Dieser Sprung von einer Agrargesellschaft ins Industriezeitalter ist Indien, trotz hervorragender Voraussetzungen wie qualifizierten und billigen Arbeitskräften, reichen Bodeschätzen, einem riesigen Binnenmarkt und einer seit jeher im Handel erfahrenen Bevölkerung, bisher nicht gelungen. So liegt der Anteil der verarbeitenden Industrie am indischen Bruttosozialprodukt mit 19% deutlich unter dem Durchschnitt der Entwicklungsländer.
Die Gründe für die frappierende Diskrepanz zwischen dem enormen Potential und der recht bescheidenen Wirklichkeit führen zurück in die Gründungsphase der indischen Republik. „Self Reliance“, selbsttragende Entwicklung, war 1948 die wirtschaftspolitische Antwort auf 500 Jahre Fremdherrschaft. Nehru sah damals in der Planwirtschaft das richtige Instrument, um Indiens Unabhängigkeit und Wirtschaftskraft zu sichern und weiter zu entfalten.
Wie im Ostblock wurden die Schlüsselindustrien verstaatlicht und das Schwergewicht der staatlichen Industrien auf Grundstoff- und Schwerindustrien gelegt, die die Grundlage für einen vom Weltmarkt möglichst unabhängigen Entwicklungsweg legen sollten. Anders jedoch als im Ostblock räumte man der privaten Industrie, vor allem den Kleinunternehmern, größeren Spielraum ein, gleichzeitig jedoch wurden die Entfaltungsmöglichkeiten durch ein engmaschiges Netz staatlicher Regulierungen und Kontrollen eingeengt. Durch die staatliche Planwirtschaft und bürokratische Reglementierung wurde das enorme wirtschaftliche Potential langfristig an die Kette gelegt und erinnerte so tatsächlich an einen eingesperrten Tiger.
Das erklärte Ziel einer weitgehenden Unabhängigkeit vom Weltmarkt und der Schutz der einheimischen Industrie wurde durch eine Zollpolitik, die fast alle Importe mit einer hohen Steuer belegte, durchaus erreicht. So gibt es in Indien kaum eine Kategorie von Industriegütern, die nicht in Indien selbst hergestellt werden. Das gilt für Kühlschränke, Autos, Computer, Flugzeuge und Satelliten, aber auch für Panzer und Raketen.
Die Kehrseite dieser Abschottung vom Weltmarkt liegt darin, dass die einheimischen Unternehmer durch die fehlende Konkurrenz weder kostengünstig noch qualitätsbewusst fertigen und indische Produkte auf internationaler Ebene kaum Käufer finden. Nur noch in traditionellen Sektoren wie Textilien, Bekleidung und Tee, die zusammen etwa 50% der Exporterlöse einbringen, ist die indische Wirtschaft konkurrenzfähig.
Da durch die gestiegenen Ansprüche der zahlenmäßig immer bedeutender werdenden Mittel- und Oberschicht die Importe zunehmend größere Ausmaße annahmen und ein Großteil der staatlichen Finanzen in die Subventionierung der chronisch defizitären Staatsunternehmen floss, stieg die Staatsverschuldung immer mehr an und die Handelsbilanz verschlechterte sich in bedrohlichem Ausmaß. Als Ende der achtziger Jahre auch noch mit dem Auseinanderfallen der ehemaligen Sowjetunion der bis dahin größte Exportmarkt Indiens zusammenbrach, stand das Land vor der schwersten Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit.
Als Indien 1991 international für kreditunwürdig erklärt wurde, konnte eine wirtschaftliche Kehrtwendung um 180° das Land noch vor dem Zusammenbruch retten. Die seither von der Regierung durchgeführten Maßnahmen zur Globalisierung der indischen Wirtschaft und das Aufgeben der bis dahin als sakrosant gesehenen Self-Reliance-Ideologie glichen einer wirtschaftlichen Revolution.
Die 20-prozentige Abwertung der indischen Rupie, die Privatisierung von Staatsunternehmen, der Abbau von Einfuhrzöllen, Subventionen, bürokratischen Reglementierungen und Antimonopolgesetze sind nur die spektakulärsten der von der Regierung angesichts der Notsituation im Eiltempo vorgezogenen Reformen. Zwar konnte mit der Senkung der Inflationsrate von 20 % auf 8,5 % innerhalb nur eines Jahres und verbesserten Devisenreserven erste Erfolge verbucht werden, doch insgesamt haben sich die Hoffnungen bisher nur in Maßen erfüllt. Bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Landes werden vor allem einige der chronischen Strukturprobleme Indiens, wie beispielsweise das völlig veraltete und unzureichende Transportwesen und die mangelhafte Energieversorgung, gelöst werden müssen. Wie soll eine moderne Industrie funktionieren, wenn Stromausfälle noch immer an der Tagesordnung sind? Als wichtigster Hemmschuh der Entwicklung von einer Agrar- zur Industriegesellschaft dürfte sich jedoch der mangelhafte Ausbildungsstand der breiten Masse der indischen Bevölkerung erweisen. Angesichts einer Analphabetenrate von knapp 50% ist es noch ein langer Weg von der Feld- zur Bildschirmarbeit.
19% der arbeitenden Bevölkerung sind in der Industrie beschäftigt. Hauptzweige stellen Maschinenbau, Eisen- und Stahlproduktion sowie die Herstellung von Nahrungsmitteln und Bekleidung dar. Zu den Wachstumsbranchen zählen die Kfz-Industrie und die vor allem im Großraum Bangalore angesiedelte Software-Industrie. Mit 2,8 Mrd. US $ trägt der High-Tech Export bereits einen beträchtlichen Teil zu den insgesamt 33 Mrd. US $ Exporterlösen bei. Indiens wichtigste Handelspartner waren Ende der neunziger Jahre die Europäische Union (26%), die USA (14 %) und Japan (5,4 %). Der Anteil der osteuropäischen Staaten bis Ende der 80er, die mit Abstand wichtigste Handelsregion Indiens, liegt nur noch bei 3 %.
Indiens Helden von heute heißen nicht mehr Mahatma Gandhi und Jawaharlal Nehru, sondern Azim Premji und Narayana Murthy. Beide wohnen im südindischen High-Tech Paradies Bangalore und sind Symbolfiguren des neuen Indien, welches nicht mehr als das Armenhaus, sondern als eine der größten Technologie-Nationen der Welt international Schlagzeilen macht. Premji mit seiner Firma Wipro gehört zu den fünf reichsten Männer der Erde. (im August 2000 nach der Berechnung vom Wirtschaftsmagazin „Business Standard“ sogar der drittreichste Mann). Murthy ist seinerseits der milliardenschwere Chef des Technologieriesen Infosys.
Ihre Jünger sind die westlich orientierten auf individuelle Entfaltung, Konsum und Globalität setzenden Jugendlichen der Großstädte. Damit hat die sogenannte MTV-Generation Visionen auf ihre Fahnen geschrieben, die im krassen Gegensatz zu den von Gemeinschaft, Sozialismus und Protektionismus getragenen Idealen der Gründungsväter stehen. Mit dem phänomenalen Aufstieg der indischen Computerindustrie geht ein fundamentaler Wertewandel innerhalb der indischen Gesellschaft einher, der das über Jahrtausende in festen Kastenschranken verharrende Gefüge innerhalb weniger Jahrzehnte aus den Angeln hebt.
Mit jährlichen Wachstumsraten von über 50% ist die Software-Industrie zu einem der wichtigsten Wirtschaftsektoren des Landes geworden. „Die industrielle Revolution haben wir verpasst, jetzt ruht unsere gesamte Hoffnung auf der Revolution der Informationstechnologie.“ So wie ein führender indischer Soziologe denkt eine ganze Generation von ambitionierten Jugendlichen, die in die „Technologieschmieden“ von Bangalore, Hyderabad und Chennai drängen.
Der neue Industriezweig beschäftigt mittlerweile 300.000 hochqualifizierte Software-Ingenieure, die im Jahr 2000 umgerechnet ca. 4 Mrd. Euro erwirtschafteten – vor zehn Jahren waren es noch 150 Mio.. 2,8 Mrd. davon gehen in den Export, zu 61 % nach Nordamerika und zu 23% nach Europa. Software-Exporte machen bereits mehr als 10 % der indischen Gesamtexporte aus. Glaubt man den Prognosen, dann sind über die nächsten 10 Jahre Steigerungsraten von 50 % jährlich zu erwarten. Mit besonderem Stolz verweist man darauf, dass jedes fünfte der 1.000 im Wirtschaftsmagazin „Fortune“ aufgeführten wichtigsten Unternehmen der Welt Software-Aufträge nach Indien vergeben hat – eine umso beeindruckendere Zahl, wenn man bedenkt, dass die indische Wirtschaft bis Anfang der neunziger Jahre fast gänzlich vom Weltmarkt abgekoppelt war.
Ein Grund für die phänomenalen Wachstumsraten ist, dass die Software-Industrie von den für den Rest der indischen Wirtschaft so typischen Entwicklungshemmnissen wie veralteter Infrastruktur, Bürokratismus und Kastendenken weitgehend unberührt bleibt.
Die Software-Industrie ist für die Generation junger, gebildeter Inder das Eintrittstor in eine goldene Zukunft. Jedes Jahr bildet Indien 75.000 Informationstechnologie (IT)-Studenten aus. Der Anfangslohn von ungerechnet etwa 500 Euro im Monat – für Indische Verhältnisse ein Spitzenverdienst (rund 30.000 Rupien) – kann innerhalb weniger Jahre auf das Vierfache steigen. Die meisten denken jedoch bereits über die nationalen Grenzen hinaus und sehen die Beschäftigung in einer indischen Computerfirma als Sprungbrett für eine Anstellung im Ausland. Als Schlaraffenland gilt hier die USA, die bei Umfragen unter Hochschulabsolventen mit großem Abstand die Nummer 1 unter den begehrtesten Arbeitsplätzen einnimmt. Neben den hervorragenden Aufstiegsmöglichkeiten und dem hohen Lohnniveau spielt hierbei auch die Tatsache eine große Rolle, dass Englisch bei den meist aus der Mittel- und Oberschicht stammenden indischen Computerprofis – Durchschnittsalter 26 Jahre – wie eine Muttersprache gepflegt wird.
80 % der Absolventen aus den sechs Elite-Hochschulen der IIT (Indian Institute of Technology) wurden 1999 von Hochschulen und Unternehmen in den USA unter Vertrag genommen. Kein Wunder, denn wer sich für einen der 2.000 IIT-Studienplätze qualifiziert, hat bereits ein knallhartes Auswahlverfahren hinter sich und zählt zur créme de la créme der ursprünglich 125.000 Bewerber. 500.000 weitere Anwärter werden erst gar nicht zur Vorauswahl zugelassen. Welche hervorragende Qualifikation die in den USA arbeitenden Software Spezialisten besitzen, belegt allein die Tatsache, dass von den 2.000 Gründerfirmen im amerikanischen Silicon Valley 40 % von Indern geleitet werden. Nur wer in Nordamerika keine Anstellung findet, versucht eventuell in der Bundesrepublik Deutschland einen Job zu ergattern.
Trotz der beeindruckenden Wachstumsraten trägt die Software-Industrie nach wie vor weniger als 1 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. Erweisen sich jedoch Prognosen als richtig, wonach die Exporte innerhalb der nächsten 6 Jahre auf 35 Mrd. US $ ansteigen sollen, würde der Anteil auf 5 bis 7 % steigen. Damit wäre die Software-Industrie endgültig die Wachstumslokomotive der indischen Wirtschaft. Mindestens ebenso bedeutend ist der mit dem wirtschaftlichen Aufschwung einhergehende soziale Wandel, der fast schon revolutionär zu nennende Veränderungen der traditionellen indischen Gesellschaft nach sich ziehen wird.
All dies ändert nichts daran, dass Indien auch nach 40 Jahren industrieorientierter Entwicklungsstrategie und Wirtschaftspolitik noch immer in erster Linie ein Agrarland ist, dessen Konjunktur mehr vom pünktlich eintreffenden Monsun und den davon abhängigen Ernten bestimmt wird als von industriellen Zyklen.
Hauptanbauprodukte bleiben Zuckerrohr, Reis, Weizen, Hülsenfrüchte und Baumwolle. Indien ist der weltgrößte Produzent von Jute, Hülsenfrüchten, Hirse und Sesam. Mit einer Gesamtproduktion von 700.000 Tonnen, wobei etwa 250.000 Tonnen exportiert werden, ist Indien der mit Abstand führende Teeproduzent der Erde. Bedeutende Erlöse werden auch mit Gewürzen, Cashewnüssen und Kaffee erwirtschaftet.
In der Besitzstruktur dominieren kleine und Kleinstbetriebe. Über die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe bewirtschaften weniger als einen Hektar Land. Rund ein Drittel der ländlichen Haushalte besitzt keinen Boden. Obwohl insgesamt 66 % aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt sind, erarbeiten sie nur 28 % des Sozialprodukts des Landes. Zudem trägt der Agrarsektor mit einem Anteil von nur 30 % zu den Exporterlösen bei. Allein diese Zahlen verdeutlichen die mangelnde Rentabilität der Landwirtschaft.
Die unmittelbare Notsituation Mitte der sechziger Jahre begründete einen fundamentalen Wandel in der indischen Landwirtschaft, der später unter dem Schlagwort „Grüne Revolution“ bekannt wurde. Die Verknappung der Nahrungsmittel ließ damals die Preise emporschnellen. Die so erwirtschafteten hohen Gewinne konnten die reichen Bauern in den Kauf von neu gezüchteten Saatgut, insbesondere Weizen investieren. Die verbesserten Saaten mit einer um etwa ein Drittel verkürzten Reifezeit erlaubten nun bis zu drei Ernten pro Jahr. Gerade für ein Land wie Indien ist die Steigerung der Flächenerträge von zentraler Bedeutung, da nur eine begrenzte Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht.
Allerdings stehen diesen offenkundigen Vorteilen gravierende Nachteile gegenüber. Der neue Weizen gedeiht nur unter Verwendung von Kunstdünger, bei Bewässerung und – wegen seiner besonderen Schädlingsanfälligkeit – unter Einsatz chemischer Pestizide. Die hierfür notwendigen hohen Investitionen konnten nur von den ohnehin schon reichen Großgrundbesitzern getätigt werden, die die Kleinbauern mehr und mehr vom Markt drängten. Während die „grünen Revolutionäre“ nicht zuletzt dank der großzügigen Subventionen der Regierung ihre Gewinne stetig steigern konnten, verloren viele Landarbeiter wegen der zunehmenden Mechanisierung der Feldarbeit ihre Arbeit. Die grüne Revolution hat zwar zu einer deutlichen und begrüßenswerten Steigerung der Ernteerträge geführt, andererseits die Kluft zwischen arm und reich noch zusätzlich vertieft.
Der eigentliche Verlierer der Grünen Revolution – und hier erscheint der Titel mehr als paradox – war jedoch die Umwelt. Durch den explosionsartigen Anstieg des Kunstdüngereinsatzes unterliegen die Böden der ständigen Gefahr der Überdüngung mit negativen Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Erträge in der Folgezeit. Noch erschreckender sind die noch gar nicht abzusehenden Auswirkungen des ausufernden Gebrauchs von Pestiziden.
Neben dem Einsatz von Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel beruht der Erfolg der Ertragssteigerung auf der zunehmenden Bewässerung landwirtschaftlich bisher nicht nutzbarer Flächen. Doch auch dieser Erfolg musste teuer erkauft werden. Der von der Weltbank finanzierte Bau riesiger Staudammprojekte zur weiteren Erschließung bisher ungenutzter Gegenden, vor allen in Gujarat und Rajasthan, führte wegen der Vertreibung tausender Ureinwohner aus ihren traditionellen Stammesgebieten zu weltweiten Protesten.
Ein Gesamturteil über die grüne Revolution fällt schwer. Die angeführten Kritikpunkte wiegen zweifellos schwer, doch sollte sich gerade der westliche Beobachter vor Augen führen, dass der indische Staat Mitte der sechziger Jahre vor der kaum zu bewältigenden Aufgabe stand, die Ernährungsgrundlage von jährlich um 18 Millionen mehr werdenden Menschen sichern zu müssen. Umweltpolitisch war ein hoher Preis zu zahlen – aber vielen Millionen Menschen wurde so das Überleben ermöglicht.
Foto: (c) Zoshua Coch