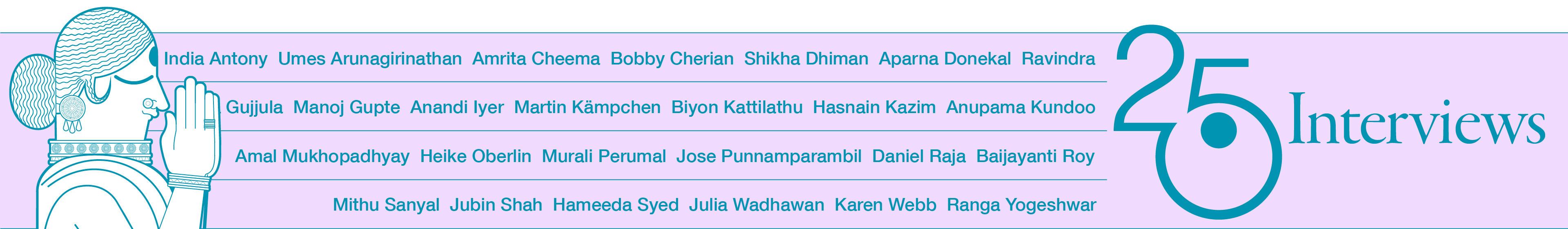Mira Nairs Spielfilm The Namesake (2006) erzählt mit großer Zurückhaltung und emotionaler Präzision die Geschichte einer bengalischen Familie, die zwischen zwei Kulturen aufwächst – und an diesem Dazwischen zugleich leidet und wächst. Die indische Regisseurin, selbst seit vielen Jahren in den USA lebend, verfilmt Jhumpa Lahiris Roman über Migration, Identität und familiäre Bindung als leise, beobachtende Chronik über drei Jahrzehnte hinweg.

Ashima (Tabu) und Ashoke Ganguli (Irrfan Khan) kennen sich kaum, als sie in Kalkutta heiraten – eine arrangierte Verbindung, wie sie in den 1970er Jahren selbstverständlich war. Doch aus der anfänglichen Fremdheit wächst Zuneigung, aus gegenseitiger Rücksicht entsteht Liebe. Ihr gemeinsames Leben in New York beginnt bescheiden: ein kleines Apartment, ein fremdes Umfeld, eine Sprache, die Stolpersteine legt. Nair schildert diese Anfangsjahre mit dem Blick für alltägliche Unsicherheiten – das Einkaufen, das Kochen, die Einsamkeit der ersten Wintertage.
Nach und nach gelingt den Gangulis der soziale Aufstieg. Sie ziehen in ein eigenes Haus, die Kinder besuchen amerikanische Schulen, die Familie verbringt die Ferien regelmäßig in Indien. Dort, im vertrauten Chaos der Heimat, sind Ashima und Ashoke wieder sie selbst. Doch ihre Kinder, Gogol (Kal Penn) und Sonia (Sahira Nair), erleben diese Reisen anders. Indien ist für sie kein Zuhause, sondern ein exotischer Ort, den sie erst mühsam einordnen müssen.
Der Sohn Gogol steht im Zentrum des zweiten Teils des Films. Sein ungewöhnlicher Name – nach dem russischen Schriftsteller Nikolai Gogol – wird zum Symbol seiner inneren Zerrissenheit. Der Name erinnert an eine Vergangenheit, die er weder gewählt noch verstanden hat. In der Schule und im Freundeskreis versucht er, ihn zu verbergen; später ersetzt er ihn durch „Nikhil“, kurz „Nick“. Doch die neue Identität bleibt Fassade. Zwischen den Erwartungen seiner Eltern und seinem Wunsch nach Unabhängigkeit schwankt er – Amerikaner unter Indern, Inder unter Amerikanern.
Erst der plötzliche Tod seines Vaters wird für ihn zum Wendepunkt. Ashoke stirbt unerwartet an einem Herzinfarkt, und die Familie steht vor der Aufgabe, das eigene Leben neu zu ordnen. Ashima, die jahrzehntelang auf die Sicherheit ihres Mannes gebaut hat, bricht unter der Last der Einsamkeit beinahe zusammen. Nair zeigt ihre Überforderung mit ruhigen, tastenden Bildern – kein offenes Drama, sondern eine stille Resignation. Sie erkennt schließlich, dass ihr Versuch, in Amerika Wurzeln zu schlagen, gescheitert ist. Am Ende kehrt sie nach Indien zurück – nicht als Flucht, sondern als späte Rückkehr zu sich selbst.
Gogol hingegen bleibt. Seine Beziehung zu Maxine (Jacinda Barrett), einer jungen Upper-Class Amerikanerin, zerbricht, nachdem sie seine Familie nicht verstehen kann. Später beginnt er eine Verbindung zu Moushumi (Zuleikha Robinson), einer Frau aus der gleichen bengalisch-amerikanischen Generation. Doch auch diese Beziehung scheitert. Die Ironie liegt darin, dass Gogol erst durch diese Enttäuschungen zu sich selbst findet, nahezu befreit wirkt. Er erkennt, dass weder Anpassung noch Tradition seine Identität vollständig bestimmen können – dass sie vielmehr in der Bewegung zwischen beidem liegt.
The Namesake ist kein lautes Migrationsdrama, sondern ein Film von stiller Klarheit und für mich ein filmisches Meisterwerk. Er erzählt nicht vom Scheitern des Aufbruchs, sondern von der Unmöglichkeit, zwei Welten völlig zu vereinen. Mira Nair verzichtet auf Sentimentalität; sie vertraut auf das authentische Spiel ihrer Darsteller – vor allem Irrfan Khan und Tabu, die mit feiner Zurückhaltung die emotionale Tiefe des Films tragen: Es sind die besonderen Szenen im Film, die in Erinnerung bleiben – Ashoke, der einen Zugunfall überlebt und der seinem Sohn aus einem bestimmten Grund seinen Namen gibt. Und dann genau der Disput um diesen Namen zwischen Vater und Sohn, der sie dann doch wieder zusammenbringt. Der plötzliche Tod Ashokes, das plötzliche Besinnen Gogols zu indischen Traditionen – dazwischen die immerwährenden Versuche Ashimas, sich zu integrieren zwischen Cornflakes und Curry.
Am Ende bleibt kein Pathos, sondern eine einfache Erkenntnis: Das Leben im „Exil“ kennt kein Ankommen, nur ein fortwährendes Aushandeln zwischen Vergangenheit und Gegenwart. In diesem Schwebezustand findet The Namesake seine stille Wahrheit – vielleicht auch meine eigene – stellvertrendend für die unzähligen Schicksale meiner Generation.